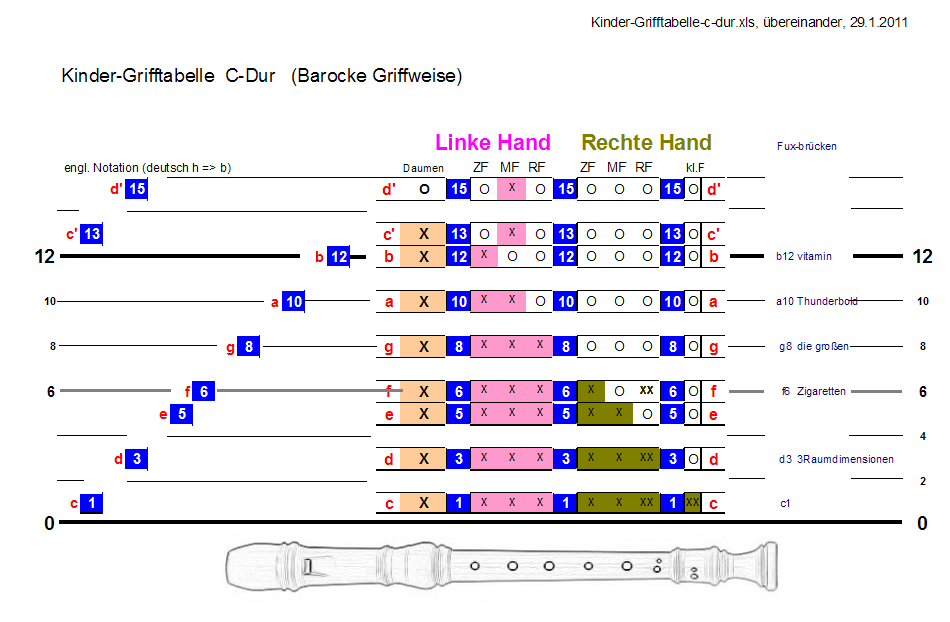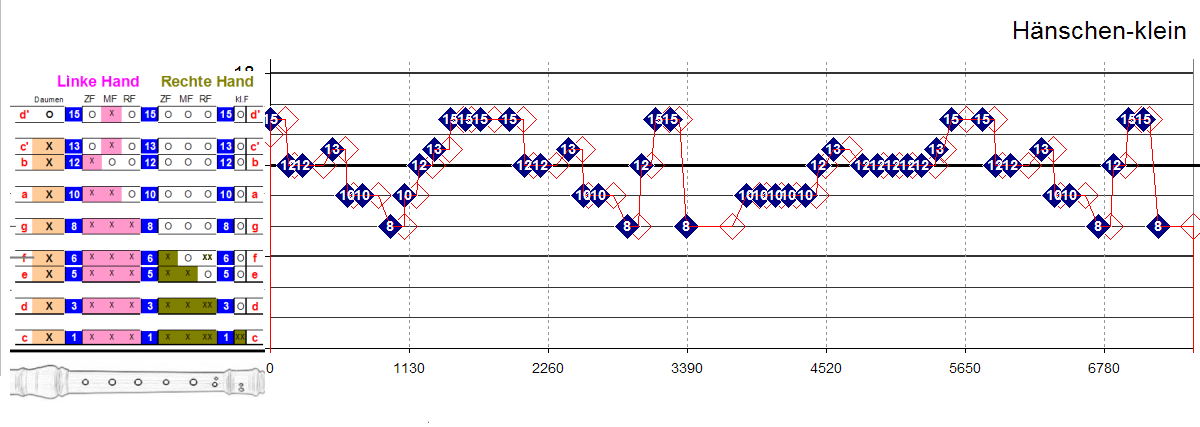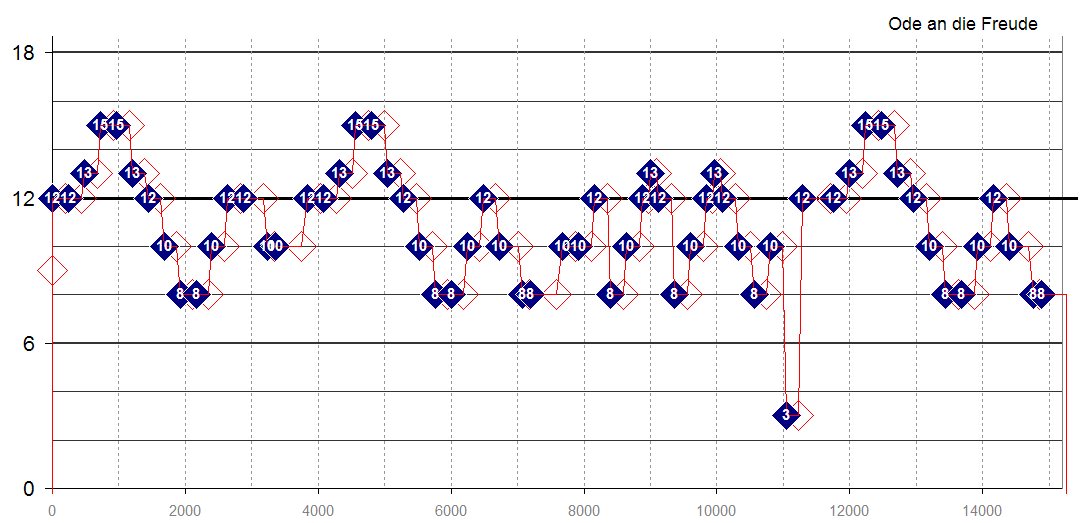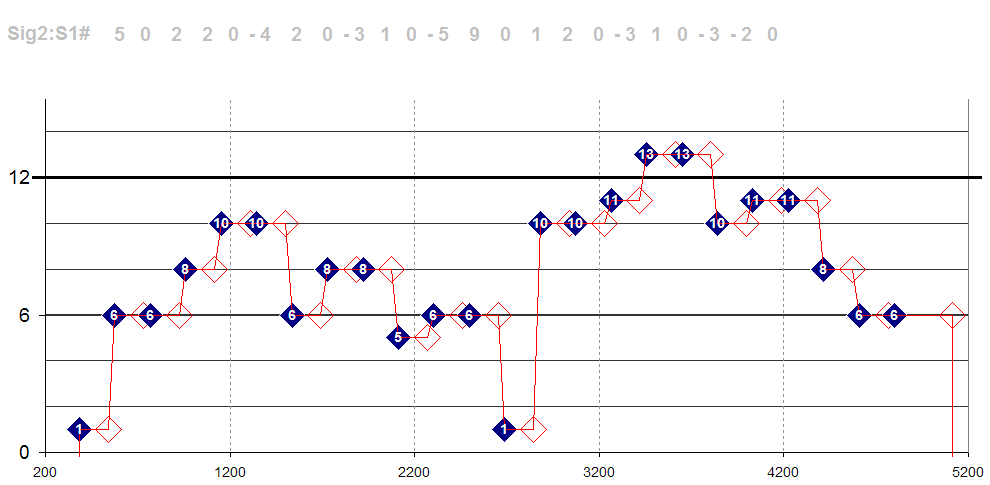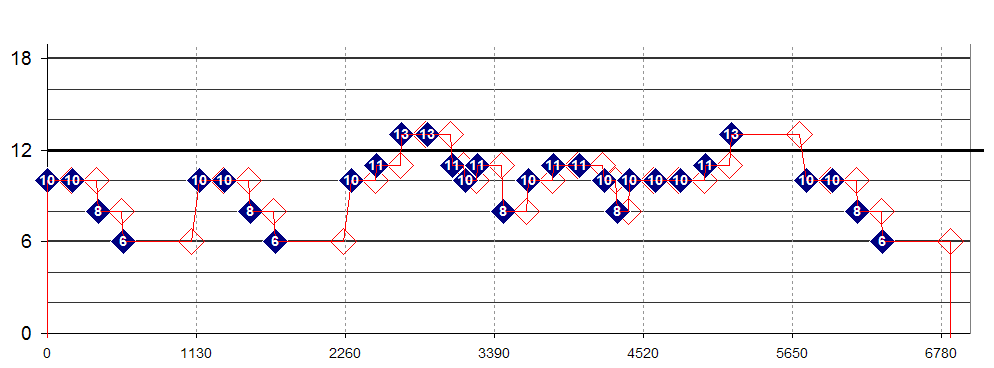Achtung
- Nur für begrenzte Zeit!
 HIER!
- voll TOP!!
HIER!
- voll TOP!!
=>
goto
down
Fließend Blockflöte in 60
Minuten (R)
* durch VÖLLIG!
NEUARTIGE LernMethodik JETZT bereits
AUCH SCHON vorgeburtlich!
...SOFORT
zugreifen und heute schon den Stein setzen für ein langes, lustiges,
mit Musik erfüllten Leben !
(mit mehreren neuen & coolen Sprüchen schon
bereits inclusive - u.a. in englisher Language!)
Außerdem mehrere (mehr oder weniger)
versteckte Ostereier zum selber suchen + finden!
1.Lektion 1 - Wie man die
Flöte richtig in die Hand nimmt und damit einen Ton macht
(ca. 8 min)
2.Lektion
2 - Wie man (beginnend mit hohen Tönen und
fortschreitend zu
tieferen) der Flöte beim Blasen die Löcher zu hält. (ca. 7 min)
3.Lektion 3 - Free-Jazz -
Modul I
4.Lektion 4 - Einiges
Theoretische überTonleitern
5.Lektion
5 - Wir lernen einige Griffe der C-Dur-Tonleiter mit Nummern
(ca. 7 min)
6.Lektion 6 - Wir üben die
Flöten- Griffe und Nummern und Notennamen (ca. 6 min)
7.Lektion 7 - Wir spielen
nach neuer Notendarstellung Hänschenklein (ca. 5 min)
8.Lektion 8 - Wir spielen
die 9. Sinfonie von Ludwig von Beethoven (nach neuen Noten) (ca. 4 min)
.Lektion 8 - kurze Pause
.Lektion 9 - Wir spielen die Werke der Spät-Klassiker sowie des
Früh-Barock und umgekehrt
.Lektion10 - Wir versuchen, Hänschenklein nach historischem Notenbild
zu spielen.
.Lektion11 - Free-Jazz Modul II
.Lektion12 -
.Lektion13 - Flötentuning bei Plastflöten: Das
Feuchte-Loch-Syndrom und was man hier tun kann.
.Lektion14
- Lektion15 -Wir spielen vor großem, internationalem Publikum
(Treffpunkt hinter der Semperoper, Zeit wird noch bekannt gegeben)
.Lektion16 - Industriepraktikum: voll krass - wir bohren unsere Flöte
auf.
.Lektion17
.Lektion18
1. Lektion
1 - der erste Ton
1.1. Die Grundhaltung: Gerader Sitz. Rücken bitte nicht so
durchhängen lassen !
Hals gerade! Augen rund! Arme locker! Nasenflügel weiten! Füße auf den
Tisch (keine Tassen umwerfen - sonst besser Fuße unten lassen!).
1.2. Nun nehmen wir die Blockflöte mit
der rechten Hand sehr
vorsichtig auf.
1.3. Die LINKE Hand OBEN -
die RECHTE
immer UNTEN !
zusätzlich
1.4. Es ist sehr wichtig, daß beide Daumen unter
der Flöte gehalten werden.
Obwohl ... wer es gut
anders kann - ist
auch OK. Bitte ein Foto für uns machen, damit alle
etwas lernen können!
Hahaha! - ein Spaß! Muß auch mal sein. Aber nun
weiter im Stoff - denn 60 min sind schließlich irgendwann auch um:
Der LINKE KLEINE Finger hat gepopelt und darf daher nicht
mit Blockflöte
spielen!
Er fühlt sich stattdessen als Dirigent - und wir wollen ihn in
dem Glauben belassen.
Jeder
andere Finger aber sucht sich nun sein am besten zu ihm passendes Loch.
Das geht ohne drängeln! Hier bitte unbedingt gleich
am Anfang passend auswählen und prüfen ob und wie sich Finger zu
Löchlein findet - ach das gute liegt so nah! Ist
die Zuordnung dann gefunden, so bleibt sie für alle Zeiten bestehen -
wer denkt, daß
spätere Löcherwechsel noch etwas einbringen, liegt total schiev - dies
ergäbe nur Mißklang aber keine Harmony mehr. Wer
sich noch nicht
100% sicher ist, daher
lieber eine/n alten Flötist(e)In befragen. Denn letztlich
ist hier alles schon vorbestimmt
(sog. Predestinationsfall), auch
wenns nicht jeder gleich merkt.
1.5. Nun endlich zum ersten Ton.
Ganz vorsichtig! - in etwa so, wie beim Enten küssen - die Lippen ganz sachte
an den Flötenschnabel bringen. (häufiger Fachterminus:
"Pittiplatsch-Ansatz")
1.6. Jetzt langsam den Ton machen (durch reinpusten).
Dabei nicht rumsabbern - die Flöte ist kein Spucknapf nicht!
1. 7. Nun erst einmal 20 sek. FREIZEIT für ALLE!
(...und bitte
die Vorbereitungen für Lektion 2 nicht vergessen!)
2.Lektion - verschiedene Töne machen
[it's] ...not so easy, from
heaven to earth...
or: Walking down the flute
(engl. etwa für: die Flötentöne herunter spazieren)
2.1.
Anblasstärke
Nun halten wir die Flöte so, daß nur noch 2
Löcher bedeckt sind - und zwar nur die:
vom linken Daumen L1 (unter der Flöte)
und das vom linken Mittelfinger L3
und blasen vorsichtig
und sanft zum Flötenschnabel hinein!
Für
ganz Übergescheite hier schon mal einiges im voraus:
Dieser
Ton - nur mit den
Fingern L1 und L3 (Daumen und Mittelfinger) ist Ton Nr. 13 - gezählt ab
dem tiefsten Flötenton. Die Länge der Schwingung in der
Flöte ist hier halb so lang wie
beim tiefsten Ton. Daher hat dieser Ton die doppelte Frequenz
(wegen gleichbleibender Schallgeschwindigkeit für beide
Töne). Tonsprünge zur doppelten Frequenz (oder
zurück) nennt man (hysterisch begründbar) Oktav-sprünge.
die Anblasstärke:
"minimal stabil"
Wir
blasen zunächst mittelstark und senken den Luftstrom dann langsam ab,
bis
der Ton zusammenzubrechen scheint. An diesem Punkt geben wir ETWAS mehr
Gas. Der Ton klingt gerade
eben stabil. Sozusagen "minimal stabil". Dies ist meist
nur ein sehr mäßiger Luftstrom.
2.2. Kanal voll?
=> ausblasen
In
der Einblasöffnung der Flöte (dem sog. Windkanal) kondensiert -
besonders bei noch kalten Flöten - Wasser aus der Atemluft. Ganz
speziell an der Austrittskante des Windkanales stören aber bereits
sehr kleine Tröpfchen spürbar die geordnete Luft-Anströmung auf das Labium und
damit die Tonbildung. Besonders die tiefsten und die höchsten Töne sprechen
dann nicht mehr richtig an. Um die Wassertröpfchen aus dem Windkanal zu
beseitigen, blasen wir einmal
sehr kräftig
in die Flöte. Die Wassertröpfchen fliegen dadurch nach vorn heraus auf das
Labium oder das weitere Flötenkopfteil (von wo wir sie abwischen
können - oder auch nicht - denn außerhalb des Windkanales stören die Tröpfchen kaum).
Damit
bei diesem Ausblasen der Flöte niemandem das
Trommelfell platzt, gibt es einen Trick: Man legt beim Blasen
einen Zeigefinger (z.B. den linken oder den
rechten)
unmittelbar über den Austritt des Windkanales. Man
kann dadurch die Lüftströmung so verändern, daß auch bei sehr
kräftigem Blasen fast gar kein hörbarer Ton entsteht.
Immer, wenn wir merken, daß tiefe oder hohe Töne gar nicht wollen, dann
blasen wir ggf. den
Windkanal aus.
Plasteflöten kann man auch auf der Heizung oder in der Sonne anwärmen,
dann entsteht erst gar kein Kondensat in der Flöte.
Holzflöten nur vorsichtig - z.B. am(!) Körper - vorwärmen.
2.3. Bei der Flöte wie am
Matterhorn - runter ist schwerer als hoch!
Daher üben wir aus Sicherheitsgründen zuerst (schön langsam!)
die Tonleiter herab
zu steigen.
Die
Finger-Bezeichnungen L1...L5, R1...R5
Linke
Hand |
Daumen=
L1
ZeigeFinger= L2
MittelFinger= L3
RingFinger= L4
Kleiner Finger= L5 |
R1 =Daumen
R2 =ZeigeFinger
R3 =MittelFinger
R4 =RingFinger
R5 =Kleiner Finger |
Rechte
Hand |
Grundhaltung ist die von Ton 13 aus 2.1.
Also: nur mit Linkem Daumen (L1) und Mittelfinger (L3):
Der Ton Nr. 13 erklingt (= Griff c')...
Nun... decken wir zusätzlich mit L2
(Zeigefinger Links) ab. Der
Ton... MUSS tiefer werden!
Nun... decken wir
zusätzlich mit L4 (Ringfinger Links) ab.
Der Ton... MUSS
tiefer werden!
Sobald
der Ton nicht
tiefer wird
sondern
höher ...
=> ist
vermutlich irgendwo etwas
UNDICHT geworden!
...anfangs
normal, da Finger und Löcher sich erst finden und
aneinander gewöhnen müssen,
später wird das schnellere Abdecken meist zur
Routine.
Also, am besten die Übung nochmal von oben anfangen - bald wird es
besser gehen!
Nun decken wir zusätzlich mit R2
(Zeigefinger Rechts) ab. Der
Ton MUSS tiefer werden!
Nun decken wir zusätzlich mit
R3 (Mittelfinger Rechts)
ab. Der Ton MUSS
tiefer werden!
Nun decken wir zusätzlich mit R4
(Ringfinger Rechts)
ab (meist Doppelloch).
Der Ton MUSS
tiefer werden!
Bis hierher war Pflicht - jetzt kommt die Kür: R5 (kl. Finger
Rechts)
Wer es jetzt schafft den Ton jetzt noch einmal tiefer werden zu
lassen, bekommt ein Extra-Lob.
Wir versuchen also zusätzlich
noch das
unterste Loch (ggf. Doppelloch) mit R5 (kleiner
Finger Rechts) abzudecken.
Der Ton muß wiederum
tiefer werden!
Damit wären wir beim tiefstmöglichen Ton angelangt - dieser
Griff heißt (tiefes) "c"
und bekommt die Nummer [1].
first slot is the deepest ( nach Yusuf
Islam: engl. in etwa: der erste Ton ist
der tiefste)
So.
Diese Übung von Lektion 2.2 wiederholt jetzt jeder für sich allein noch
700 mal.
Nach jedem 100sten mal ein Vater Unser oder alternativ
ein paar Suren dann Pause.
Ich werde derweil eine Schokozigarette paffen und uns
allen einen Tee machen.
----
Hallo, oh - schon fertig?
Einige
ganz Oberschlaue werden vielleicht bemerkt haben, daß es einen
Zusammenhang gibt
zwischen der Länge des mit Fingern abgedeckten Flötenrohres und der
Tonhöhe. Je
kürzer die Röhre desto höher klingt die Flöte. Sehr richtig beobachtet:
Je Kürzer
der Schwingungsbogen - desto Höher
der Ton. Und umgekehrt.
Je Länger
der Schwingungsbogen - desto T.........der
Ton.
(Hier bitte selbst
ausfüllen - aber bitte bei den empfindlichen Flachbildschirmen mit
besonderer
Sorgfalt)
Anmerkung speziell für die philosophisch interessierten:
Es ist gewiss kein Zufall, daß sowohl K und H einerseits
als auch L und T sich recht ähnlich sehen.
Wer dennoch eine Eselsbrücke braucht (in Abwandlung traditioneller Volkspoesie): "Kurz und dick - Höchstes Glück. Lang und schmal - Tiefe Qual."
Wie so oft - diese
einfache Regel ist jedoch
nur die halbe Wahrheit von der ganzen!
Denn zur ganzen Wahrheit
gehört es auch, daß bei allen bisherigen
Tönen nur eine
einzige
Schwingung (bzw.
Schwingungsbogen) im Flötenrohr vibriert hat. Nämlich: von der Öffnung
beim Schnabel bis zu dem jeweils obersten offenen (also nicht
abgedeckten) Loch.
Wie
man auf derselben Flötenlänge auch einen Ton mit Doppelschwingung und
dadurch in doppelter Frequenz (Oktavsprung) anregen kann, das lernen
wir in der...
3.Lektion
3 - FreeJazz - Modul I
Twice the fan, double the troubel
(engl. in etwa für: zweifaches Gebläse => doppelte Frequenz)
3.1. Überblasen
Bei
schwächerem Blasen entsteht in der Flöte eine einzelne stehende Welle
(Schwingungsbauch): vom Fötenkopf bis zum ersten offenen Loch. In der
Mitte ruht die Luft - an den Enden schwingt die Luft kräftig hin und
her. (~||~)
Wenn man zunehmend stärker blast, dann kommt mehr und mehr Energie in
die Flöte.
Bei
einer bestimmten Blasstärke kippt der Ton plötzlich zu einer deutlich
höhreren (der zweifachen!) Frequenz um. Dann stehen
zwei kürzere
(stehende) Wellen in der Flöte. (~||~~||~)
Jede ist nur halb so lang wie
die ursprüngliche Welle. Das FrequenzIntervall zur doppelten Frequenz
wird auch als
Oktavsprung bezeichnet, weil in europäischen Kulturkreisen ursprünglich
meist 7
(heptatonische) Töne in dieses Intervall gepackt wurden.
Das Überblasloch (=L1)
Wir blasen einen Grundton
mit weit bedeckter Flöte - z.B. den Griff "e":= L1, L2,L3,L4,
R2,R3
Wir erhöhen den Blasdruck - aber so, daß der Grundton erhalten bleibt.
Nun öffnen wir nur leicht
beim linke Daumen (das "Überblasloch"). Dadurch erleichtert
sich
das Schwingen der Luft im Bereich der Flötenmitte erheblich. Deshalb
kippt der Grundton nun schon viel eher (heisst: bei geringerem
Blasdruck =
Energie) zur doppelten Frequenz (Oktavsprung). Praktisch erzwingt das
leichte Öffnen des Überblasloches den Oktavsprung.
Wichtig!
Wenn das Überblasloch zu weit geöffnet wird, dann tritt zu
viel
Energie an diesem Punkt aus der Flöte aus und es kann keine zweite
Schwingung mehr unterhalb es Daumenloches angeregt werden - daher nur
leicht und mit Gefühl öffnen - bis der Ton kippt. Das Überblasen wird
in Grifftabellen als halb geschlossen
und halb geöffnet
symbolisiert [xo].
(Es gibt auch drei [nicht überblasene] Töne, bei denen das
Daumenloch vollkommen geöffnet wird.)
Übung:
Wir probieren für alle (tieferen) Grundtönen auch das Überblasen zur
doppelten Frequenz.
Zuerst ohne Überblasloch - mit sehr starkem Luftdruck -
danach mit Überblasloch.
Lektion 4 -
Große Musik-Theorie: Tonleitern
Bei
der vollständigen Tonleiter (z.B. die Tasten auf einem Klavier) steigt
die Tonfrequenz von Taste zu Taste immer in gleichen
Schritten (d.h. im gleiche FrequenzVerhältnis!)
um etwa 6% an. Diesen Tonschritt nennt man auch einen halben Ton
oder
Halbton. Die so entstehende Tonleiter nennt man auch chromatische
Tonleiter. Durch die Frequenzanhebung um jeweils ca. 6% zum nächsten
Ton kommt man nach 12 Schritten (also beim 13. Ton) bei der
doppelten Frequenz (also bei Flöte dem Überblas-Ton) an. Diese
chromatische Tonleiter hat also 12 Töne pro
Frequenzverdoppelung (pro Oktave).
Alternative Bezeichnungen für diese chromatische Tonleiter:
zwölfstufige Tonleiter; vollständige
Halbtonleiter
Vereinbarungen für gleichbedeutende Bezeichnungen:
Halbtonschritt = Tonschritt
Ganztonschritt = zwei
Halbtonschritte
Auf
der Blockflöte (in Barocke Griffweise!) ist es möglich, beginnend z.B. vom
tiefsten Ton (alle Löcher zuhalten und sanft blasen) mehr als 24
aufeinander folgende Töne in ununterbrochener Reihenfolge durch
richtige
Griffe zu erzeugen.
Deshalb kann man auf der
(barocken)
Blockflöte praktisch bereits jede beliebige Melodie spielen, die man auch auf einem
gewöhnlichen Klavier (innerhalb zwei Oktaven) abspielen kann.
Daß dieses
mit einem Instrument von prinzipiell recht einfacher Bauweise gelingt,
ist nicht selbstverständlich sondern Resultat bemerkenswerten Forschens und Bemühens schon in
früheren Jahrhunderten sowie guter Genauigkeit in der
baulichen Ausführung (Sitz und Größe aller Bohrungen) unserer Blockflöten.
Wir nummerieren nun die Töne der Blockflöte und beginnen mit 1
beim tiefsten Ton (wenn alle Löcher abgedeckt sind).
Vereinbarung:
Den
Griff für diesen tiefsten Ton bezeichnen wir als "Griff Nr.1" oder
alternativ auch als "Griff c"
- unabhängig von der Größe der Flöte (und damit von der tatsächlichen
Tonhöhe).
Abhängig von der Größe des jeweiligen Instuments erklingen beim
"gegriffenen c" also verschiedene Töne. Dadurch können wir verschieden
große Instrumente nach gleichem Griffschema spielen.
Bei
der c-Sopranflöte erklingt allerdings tatsächlich ein
"c". Die Griffbezeichnungen richten sich (übrigens auch bei
anderen
Blasinstrumenten) üblicherweise immer nach
den c-Instrumenten.
Einen ganzen Ton (zwei Halbtonschritte) höher (1+2=Nr. 3)
ist: "d". L1,
L2,L3,L4, R2,R3,R4
Noch einen Ton (zwei Halbtonschritte)
höher (3+2=Nr. 5) ist: "e". L1,
L2,L3,L4, R2,R3
Viele Musikstücke benutzen nur eine TEILMENGE von Tönen der
zwölfstufigen (chromatischen) Tonleiter.
Je nach Auswahlregeln für
die Teilmenge unterscheidet man TONARTfamilien.
Sehr häufig sind DUR- und MOLL -
Tonarten.
Pro Oktave
werden 7 Töne ausgewählt und zwar bei MOLL nach dem folgendem
Prinzip:
Zu einem (beliebig wählbaren) tonartbezeichnenden
Grundton x
nimmt man (aufsteigend) die
folgenden Halbtonschritte:
Schrittmuster bei MOLL: x + 2+1
+2 +2+1
+2 +2
Addiert man all diese Schritte zusammen, dann kommt man auf 12
(Halbtonschritte) und die Oktave ist damit voll.
Beginnt man diese
Tonleiter mit Ton "a", dann kommt man zu den Tönen: a b c d e f g (a')
= A-Moll.
A-Moll ist also die
Tonleiter, in welcher die sieben Töne a...g
in Alphabetischer Reihenfolge, beginnend bei a liegen.
Bei (allen) Molltonarten liegen die Halbtonschritte (+1) (immer)
bei den Schritten 2-3 und 5-6.
. Schrittweite: x +2+1 +2 +2 +1 +2
+2
a-moll:a- -b-c- -d- -e-f- -g- -a' .
c-dur: c- -d- -e-f- -g- -a- -b-c'
C-Dur
benutzt genau dieselben Töne wie a-moll, beginnt jedoch beim
Ton c, geht
mit d, e-f, g
weiter, erst dann folgen a, b und das c'
der nächsten Oktave.
Bei C-Dur liegen die halben Tonschritte demnach
zwischen den Schritten 3-4
und 7-8.
Das ist auch bei allen anderen DUR-Tonarten immer so.
C-Dur-Tonleiter:
Schrittweite: x+2 +2 +1
+2 +2 +2 +1
TonName: c-
-d- -e-f- -g- -a- -b-c'
StufeNr: 1 3 5-6
8 10 12-13
cdef....c'd'e'f'.....c''d''e''f''
Aus historischen Gründen hat es sich eingebürgert, die Bezeichnung des Oktavwechsels immer (für
alle Tonarten!) genau an derselben Stelle wie bei C-Dur zu setzen
- also immer bei einem C mit dem Wechsel bei der Stichsetzung (oder dem
bei der Groß/KleinSchreibung) zu beginnen:
z.B.: a-moll: a b c' d' e' f' g' (a')
od. eine Oktave tiefer: A B c d e f g (a)
od. G-Dur G A B c d e f# g usw.
Chromatische
Tonleiter:
Die
Bezeichnungen aller anderen Töne aus der chromatischen Tonleiter
ergeben
sich aus der Bezeichnung des nächsttieferen Tones der C-Dur (oder -
gleichbedeutend a-moll) Tonleiter durch Anhängen
des Kreuzzeichens "#" bzw. der Silbe "is".
Beispiele: Ton zwischen c und d: c# = cis
chrom. Ton über d:
d# = dis
chrom.
Ton über a:
a#=ais
chrom.
Ton unter b:
a#=ais
Eine (vollständige) chromatische Tonleiter geht demnach
(stets in Halbtonschritten) so:
|------Blockflöte----------------------------------------...
(ZU)TIEF |
|- hoch'---(überblasen)- -...
TonName:..
A A# B c c#
d d# e f f# g g# a
a# b c' c#' d' d#' e' f' f#'
...
StufeNr:..-2 -1 0 1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 ...
A Ais B c cis d
dis e f fis g gis a ais b
c'cis' d'dis' e' f' fis'
Vereinbarung:
Wir nennen den tiefsten Blockflötenton immer als "Griff c
" und geben ihm die "GriffNummer 1".
Vereinbarung:
Wir werden im folgenden häufig Doppelbezeichungen für die Noten
verwenden,
also statt "a" sagen wir: "a10", statt "d" sagen wir "d3", statt "dis"
sagen wir "dis4" usw.
Obwohl das eigentlich
nicht nötig ist, können wir auf diese Weise gut
die Notenposition im chromatischen
Tonraum einüben. Das wird uns später
den Weg zum Ruhm
erleichtern.
Lektion
5 Grifftabelle C-Dur: c--d--e-f--g--a--b-c'
Als nächstes lernen wir die Grundgriffe der
C-Dur-Tonleiter.
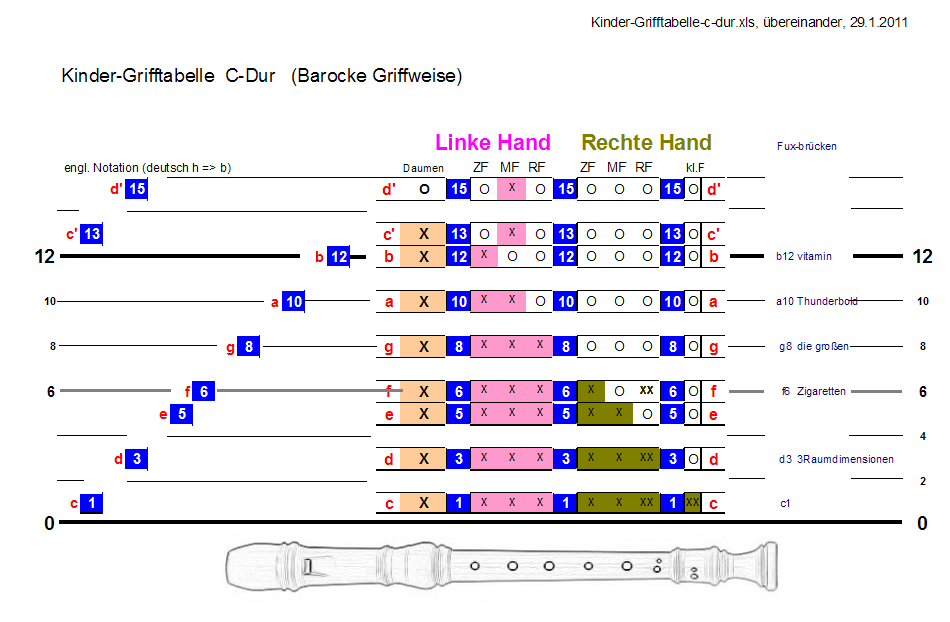
Tonloch
x
= geschlossen O =
offen
Wir prägen uns zu den Tonbezeichnungen (c d e f g a b c')
stets auch die dazugehörigen TonstufenNr.
mit ein!
Wenn die Zuordnung von Ton
zu Nr.
schwer fallen, dann kann man die Fuxbrücken (rechts blau) mit
zuhilfe nehmen.
Tonnummern
Fuxbrücken
| c1 |
sowieso klar (C=Startton) |
| c# |
|
| d3 |
3 Dimensionen des Raumes |
| d# |
|
| e5 |
|
| f6 |
...berühmte Zigarettenmarke |
| f# |
|
| g8 |
einstmals die Großen |
| g# |
|
| a10 |
ein sonderbares (Militär-)Flugzeug |
| a# |
|
| b12 |
ein Vitamin |
| ... |
... |
| g'20 |
auch so ein großmächtiger Klub. |
Lektion
6 - Wir üben die Flöten- Griffe und Nummern und Notennamen
(ca. 6 min)
Es ist sehr
nützlich, die Dreierkombination:
Ton <=> Nr <=> Griff <=>
Ton
in jeder Richtung denken
zu können!
Übung: Beim Spielen eines Tones:
Blick
auf den Griff + Denken
des Tones + Denken der Nummer (ggf. mit Eselsbrücke)!
Wir
"dilettieren" mit den
Griffen der C-Dur-Tonleiter und denken dabei Töne und Nummern!.
Übung: Folgende Griffe der Linken Hand: g8 a10 b12 c'13 d'15
sollen jetzt sehr gut sitzen!
Wenn die GriffNummer gedacht wird dann
sollte jetzt Buchstabe
und
Griff vor
Augen sein!
Lektion
7 - Wir spielen nach neuer Notendarstellung Hänschenklein
(ca. 5 min)
Lied: Hänschenklein (es
werden nur die Finger der linken
Hand benötigt!)
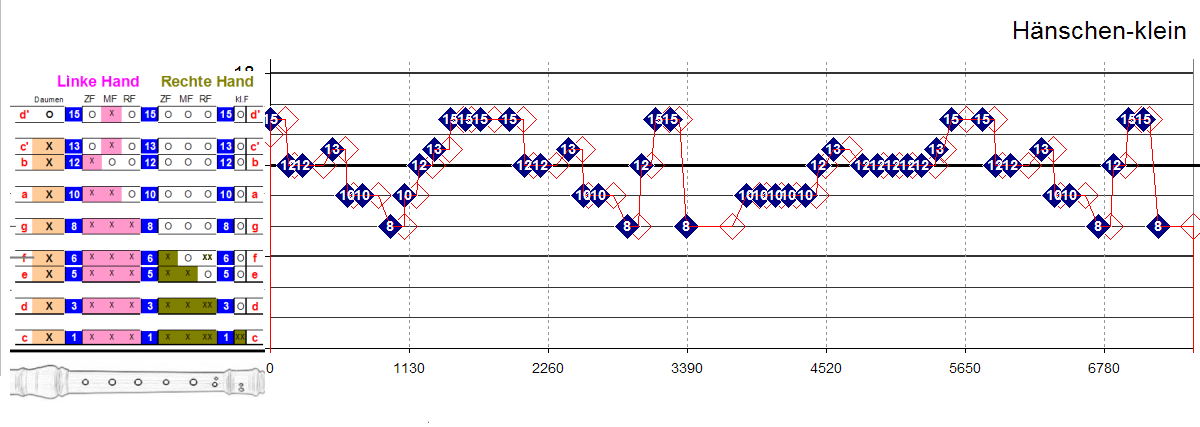
Lektion 8 - Wir
spielen die 9. Sinfonie von Ludwig von Beethoven (nach neuen Noten)
(ca. 4 min)
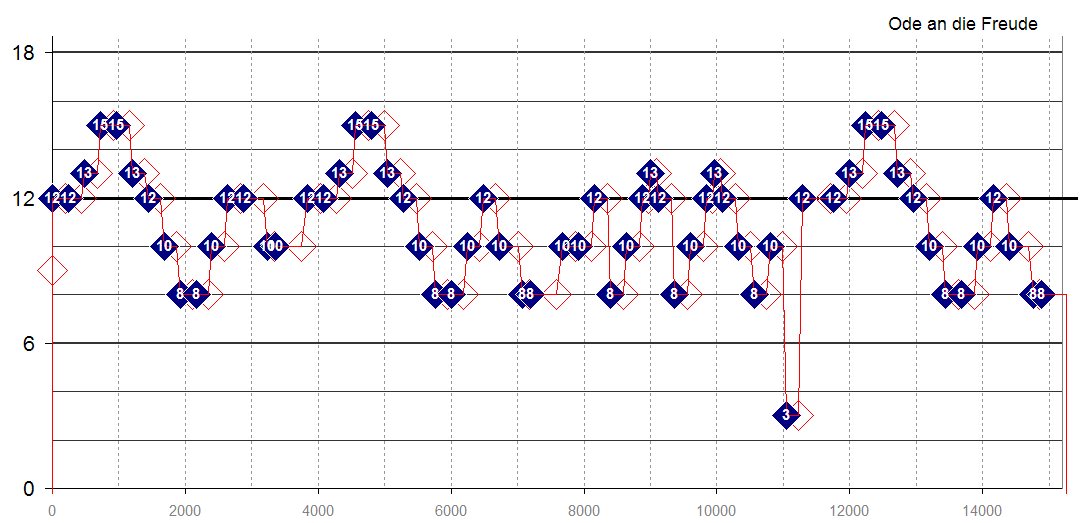
Weitere Perfektionierungen
Übungen:
1. C-Dur Tonleiter spielen: hoch und runter und
runter und hoch.
2. Wir improvisieren - benutzen dabei aber nur die Töne der c-Dur
Tonleiter.
3. Wir lernen den Ton ais=a#=11. Dieser wird gegriffen wie
der Ton b=12 jedoch wird zusätzlich noch mit dem linken Ringfinger abgedeckt (wie bei Ton g=8). Weil diesmal aber das dazwischen liegende Loch (hier unter dem Li.Mittelfinger) offen bleibt, nennt man solche Griffe "Gabelgriffe".
Mit der C-Dur-Tonleiter und zusätzlich dem Griff Nr.
11=a#=ais können wir nun (sehr schön langsam!)
das nächste Lied versuchen: (Nicht vergessen, auch die
Notennamen mit zu denken!)
Lied:
"Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder, den Frühling, den Sommer
den Herbst und den Winter."
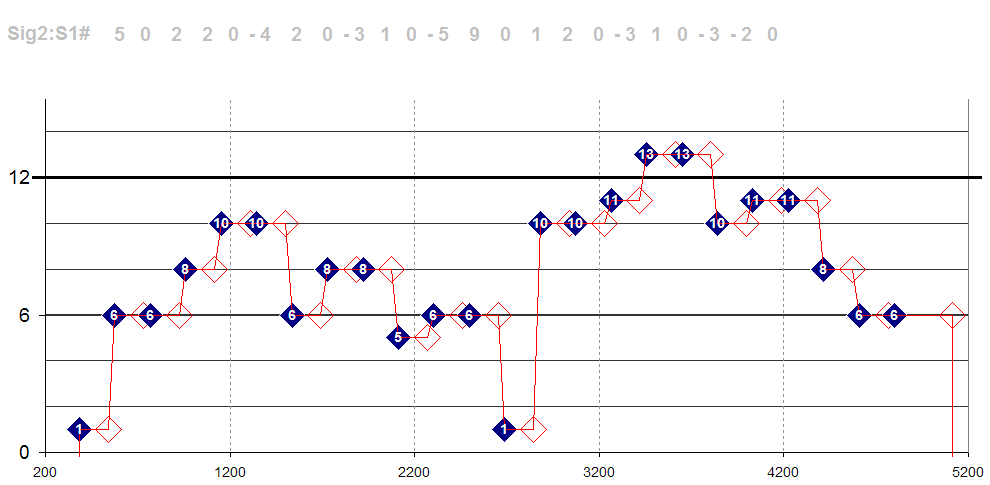
Winter Ade
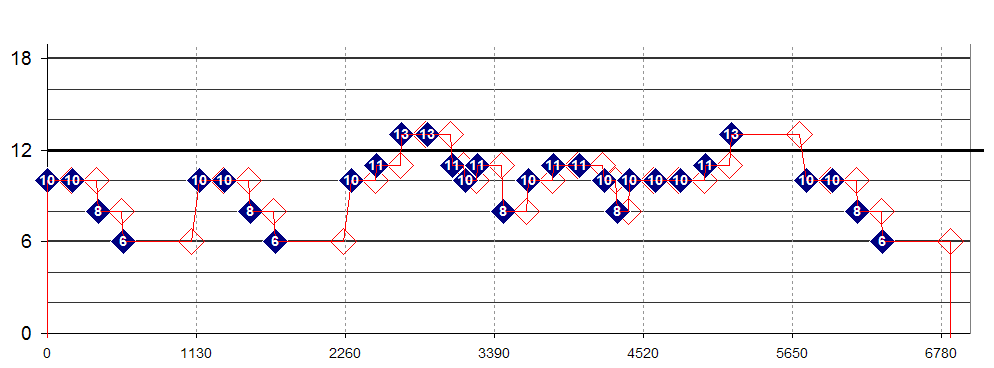
Weitere Lieder mit Zahlen...
http://customcranks.de/musika/konvert/Mit%20Zahlen/index.php
Wir
prägen uns die Positionen der c-Dur Noten im chromatischen
Liniensystem gut ein.
Diese Nummern werden in Zukunft meist nicht mehr bei der Note
stehen sondern müssen aus der Position ersehen werden.
Die halbfette Oktavmittenlinie ist f6,
c'13 hat zur fetten Oktavlinie b12 die analgoge
Position wie c1 zur Nullinie (B0).
Die relativen Notenpositionen wiederholen sich daher exakt in jeder Oktave.
(Bei dem veraltet hergebrachten LinienSystem ist dies [leider] nicht so!)
Die anderen Linien der ersten Oktave sind gerade
Zahlen 2,4 und 8,10.
Große
(chromatische) Grifftabelle:
Als
angehende große Künstler wenden wir uns nun der Großen Grifftabelle mit
Griffen für alle Zwischentöne aus der (chromatischen)
Tonleiter
zu.
Zunächst konzentrieren wir uns darauf, die noch fehlenden Töne
unterhalb von d'15 zu ergänzen:
Zu den
C-Dur Tönen kommen noch hinzu: c'#14 a#11(schon
gelernt)
g#9 f#7 d#4
c#2

Tonloch... x
= geschlossen O =
offen xo = halboffen
Alle grünlich
hinterlegten Felder können zunächst ignoriert werden
- d.h.
diese Löcher können vereinfacht gegriffen alle offen bleiben,
weil dies nur sehr geringe
Tonhöhenunterschiede bewirkt (je heller das Grün - desto geringer der
TonhöhenUnterschied).
f6:
Wir nehmen jetzt jedoch zur
Kenntnis, daß der (wichitge) Ton f
6,
welchen wir
bisher stark vereinfacht
gegriffen haben, in Wirklichkeit ein Gabelgriff unter Mitwirkung des
rechten Ringfingers ist! Dadurch klingt der Ton etwas tiefer.
Noch genauer klingt das f bei zusätzlichem Abdecken durch den REchten kleinen Finger
- dies
ist jedoch schwierig und der hierdurch bewirkte TonhöhenUnterschied (Tonabsenkung) nur sehr
gering.
Die Halbabdeckungen (xo) bei den Tönen Cis und
Dis erfordern besondere Übung.
Bei Flöten mit Doppelloch wird hier nur das
rechts liegende Loch abgedeckt.
Die richtige Halbabdeckung des Überblasloches
mit dem linken Daumen erfordert Gefühl und Übung.
(Falls
bei sehr kalter Umgebung Kondenswasser zum Überblasloch heraus auf den
Daumen fließt, dann ist die korrekte Teilabdeckung des
Überblasloches sehr schwierig. Läßt sich die Kondensatbildung nicht
vermeiden, kann man einen kleinen passenden Zylinder in das
Überblasloch eisetzen (einkleben), an welchem das Kondenswasser dann
vorbei fließen kann. Diese Lösung findet man auch bei Klarinetten,
Oboen und Saxophonen)
*
here full DOWN.
=> goto Top
 HIER!
- voll TOP!!
=>
goto down
HIER!
- voll TOP!!
=>
goto down